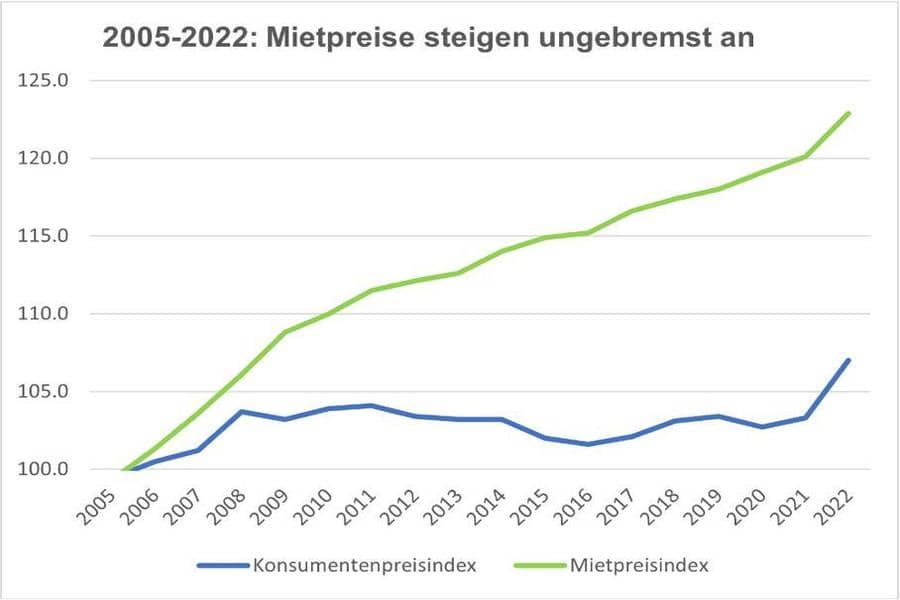Wer vorübergehend ins Ausland verreist, kann seine Wohnung untervermieten. Auch bei WGs ist die Untermiete beliebt. Nicht so bei der Immo-Lobby: Mit einer parlamentarischen Initiative will sie das Recht auf Untervermietung empfindlich schmälern.
Ein lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung, als Marta Stucki die Bestätigung der renommierten Musikschule Berklee College of Music in Boston in den Händen hält. Die Musikstudentin wird ihren Wohnsitz für ein halbes Jahr von Zürich in die USA verlegen, um dort zu studieren. Ihre liebgewonnene 2-Zimmer-Wohnung in Zürich will sie auf jeden Fall behalten. Weil sie sich zwei Mieten aber nicht leisten kann, möchte Stucki ihre Wohnung für die Dauer ihres Auslandaufenthalts einem Kollegen untervermieten. Diesem Vorhaben muss ihre Vermieterin zustimmen. Dies würde auch dann gelten, wenn Stucki nur einzelne Zimmer der Wohnung untervermieten möchte, wie dies oft bei Wohngemeinschaften der Fall ist. Die Vermieterschaft darf die Zustimmung laut Art. 262 OR allerdings nur aus ganz bestimmten Gründen verweigern.
Vermieterschaft darf Bedingungen erfragen
Ein erster Verweigerungsgrund betrifft die Transparenz. Die Vermieterin hat das Recht, die Bedingungen der Untermiete zu kennen, insbesondere den Untermietzins. Darüber hinaus darf sie wissen, wem Stucki die Wohnung untervermietet und wie lange dies gelten soll. Dafür kann sie beispielsweise eine Kopie des Untermietvertrages verlangen. Enthält Stucki ihrer Vermieterin diese Informationen vor, kann diese die Zustimmung zur Untermiete verweigern. Ein weiterer Grund für eine Verweigerung entsteht, wenn Stucki falsche Angaben macht oder wenn sie die Vermieterin zwar über die Bedingungen der Untermiete informiert, diese aber missbräuchlich sind.
Keine missbräuchlichen Bedingungen
Missbräuchlich wäre das Untermietverhältnis dann, wenn Stucki damit ein Geschäft machen würde, indem sie vom Untermieter mehr verlangen würde, als sie selbst für die Wohnung bezahlt. Ganz strikt lässt sich diese Regel allerdings nicht durchziehen. Einen Zuschlag von wenigen Prozent könnte Stucki verlangen, denn sie trägt durch die Untervermietung ein gewisses Risiko. Bezahlt ihr Untermieter beispielweise den Untermietzins nicht, so schuldet Stucki ihrer Vermieterin trotzdem die volle Miete. Auch für allfällige Schäden des Untermieters haftet Stucki gegenüber ihrer Vermieterin. Ihren Untermieter könnte sie zwar dafür belangen. Ist dieser jedoch zahlungsunfähig, so bleibt sie auf dem Schaden sitzen. Wird die Wohnung möbliert untervermietet, kann dies einen weiteren kleinen Zuschlag rechtfertigen. Wie viel Zuschlag generell bei der Untermiete gerechtfertigt ist, lässt sich nicht allgemein beantworten. Der Zuschlag muss aber auf jeden Fall durch zusätzliche Kosten oder zusätzliche Leistungen erklärt werden können. Andernfalls ist er missbräuchlich, und die Vermieterschaft kann die Untervermietung zu Recht verweigern.
Ablehnung wegen wesentlicher Nachteile
Die Vermieterin kann ihre Zustimmung zur Untervermietung auch dann verweigern, wenn diese für sie mit wesentlichen Nachteilen verbunden wäre. Eine Überbelegung der Wohnung etwa muss sie nicht tolerieren. Dasselbe gilt, wenn der Gebrauchszweck der Wohnung durch die Untervermietung verändert würde. So etwa, wenn Stuckis Kollege sie als Werkstatt nutzen möchte. Zudem ist eine Untervermietung der gesamten Wohnung auf unbestimmte Zeit laut dem Bundesgericht unzulässig. Die gesamte Dauer der Untervermietung muss zwar nicht im Voraus feststehen. Es muss aber absehbar sein, dass die Hauptmieterschaft in naher Zukunft wieder in die Wohnung zurückkehrt. Werden dagegen nur einzelne Zimmer untervermietet und wohnt die Hauptmieterschaft ebenfalls in der Wohnung – wie bei einer WG der Fall –, ist auch eine unbefristete, auf längere Frist angelegte Untervermietung zulässig.
Realitätsfremde Initiative der Immo-Lobby
Diese wichtige Differenzierung will die Immo-Lobby verunmöglichen. Mit ihrer parlamentarischen Initiative, die in der aktuellen Session vom Nationalrat behandelt wird, will sie die Untervermietung in allen Fällen auf zwei Jahre begrenzen. Das ist realitätsfremd: Ein Auslandstudium oder ein vorübergehender Arbeitsaufenthalt im Ausland – sei es für ein Unternehmen oder bei einer Mission für eine Internationale Organisation wie das IKRK – dauert oft vier Jahre. Auch für Studierende, die wegen des Studiums in die Schweiz ziehen und ein WG-Zimmer mieten, sind die zwei Jahre viel zu kurz, zumal ein Studium deutlich länger als zwei Jahre dauert.
Form der Zustimmung
Die Vermieterschaft muss einer Untervermietung nicht unbedingt schriftlich zustimmen. Sie kann dies auch mündlich, per Handschlag oder sogar stillschweigend tun. Geht es jedoch nach der Immo- Lobby, so soll die Untervermietung künftig nur noch mit schriftlicher Zustimmung der Vermieterschaft erlaubt sein. Ohne diese soll die Vermieterschaft den Mietvertrag gar kurzfristig kündigen können – so der Initiativtext. Dasselbe soll gelten, wenn die Mieterschaft falsche Angaben zur Untermiete macht oder die Vermieterschaft nicht über Änderungen informiert. Diese Bestrebungen der Immo-Lobby sind obsolet, und zwar in zweifacher Hinsicht: Vorsichtige Mieter*innen werden zu Beweiszwecken ihre Anfragen um Zustimmung zur Untervermietung immer schriftlich stellen, und es liegt auch im Interesse der Vermieterschaft, schriftlich zu antworten. Ein ausserordentliches Kündigungsrecht nur wegen Nichteinhaltung einer Formalie ist zudem unverhältnismässig und mit dem verfassungsmässig garantierten Schutz vor missbräuchlichen Kündigungen wohl schwer zu vereinbaren.
Was tun bei Verweigerung?
Verweigert die Vermieterin Stucki die Zustimmung zur Untervermietung, so kann diese sich an die Schlichtungsbehörde wenden. Sich einfach über die Ablehnung hinwegzusetzen oder erst gar nicht bei der Vermieterschaft anzufragen, ist Stucki hingegen nicht zu raten. Da es sich dabei um eine Vertragsverletzung handeln würde, könnte ihr die Vermieterin kündigen. Stucki könnte diese Kündigung zwar anfechten und die Schlichtungsbehörde müsste dann prüfen, ob die Untervermietung zu Unrecht verweigert wurde. Ist dies der Fall, so müsste die Schlichtungsbehörde die Kündigung aufheben. Da die Ablehnungsgründe einen gewissen Ermessensspielraum zulassen, sollte es Stucki aber besser nicht darauf ankommen lassen.
Mieter*innen zweiter Klasse
Rechtlich gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen Mieter*innen und Untermieter*innen. Sie haben grundsätzlich dieselben Rechte. Folglich muss Stucki als Untervermieterin genau die gleichen mietrechtlichen Regeln beachten wie grosse Liegenschaftsverwaltungen, wenn sie ihren Kollegen als Untermieter in ihre Wohnung aufnehmen möchte. Im Fall einer Kündigung sind Untermieter*innen trotzdem schlechter geschützt als Hauptmieter*innen. Kündigt Stucki als Hauptmieterin ihrem Untermieter, so kann dieser zwar die Kündigung als missbräuchlich anfechten und eine Mieterstreckung verlangen. Das Untermietsverhältnis kann jedoch nicht über das Ende des Hauptmietverhältnisses hinaus erstreckt werden.
Schlechte Karten bei Kündigung
Noch verzwickter ist die Situation, wenn die Vermieterin Stucki als Hauptmieterin kündigt. Der Untermieter kann in diesem Fall gegenüber der Vermieterin keine Erstreckung verlangen, da er mit dieser nicht in einem Vertragsverhältnis steht. Dies müsste Stucki als Hauptmieterin tun. Da Stucki die Wohnung aber nicht selbst bewohnt, sondern in Boston weilt, ist sie von der Kündigung nicht persönlich betroffen. Deshalb wird es ihr auch nicht gelingen, die für eine Erstreckung erforderlichen persönlichen Härtegründe geltend zu machen.
Findige Vermieter*innen könnten dies ausnutzen und den Kündigungsschutz mit einem fiesen Trick aushebeln, indem sie die Wohnung einer Vertrauensperson vermieten, die dann die Wohnung ihrerseits weiter untervermietet. Um dies zu verhindern, sieht das Gesetz mit Artikel 273b Abs. 2 OR eine Schutzbestimmung vor: Wurde ein Untermietsverhältnis hauptsächlich zur Umgehung der Kündigungsschutzbestimmungen abgeschlossen, haben die Untermieter*innen trotzdem ein Erstreckungsrecht.
Der Schutz der Untermieter*innen müsste allerdings noch weiter ausgebaut werden. Gründe, wieso Untermieter*innen gegen Kündigungen schlechter geschützt sein sollen als Hauptmieter*innen, gibt es eigentlich keine. Die Vermieterschaft hat der Untervermietung ja zugestimmt.
Autor: Fabian Gloor