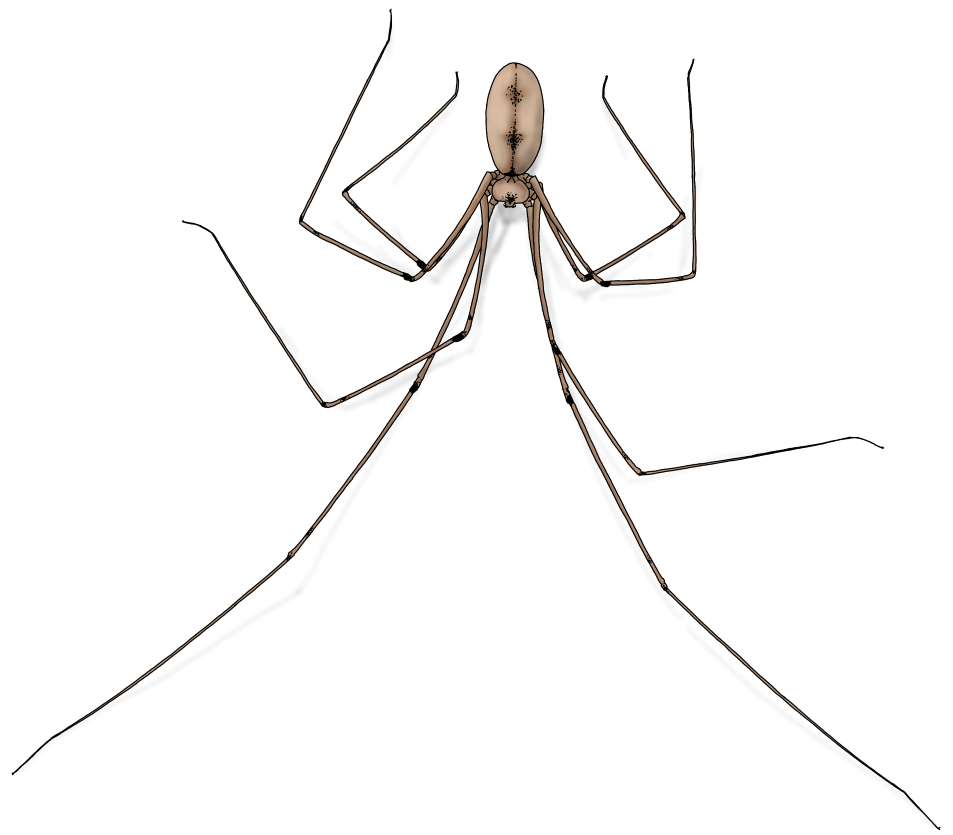Mit einer sozial nachhaltigen Strategie könnten die SBB in den nächsten Jahren viel bezahlbaren Wohnraum schaffen. Der Auftrag des Bundes ist aber ein anderer. Deshalb kämpft der Zürcher Kreis 5 jetzt für die ganze Schweiz.
Kaum ist das gigantische «KCBR»-Graffito, das seit vergangenem Herbst den Kamin der Kehrichtverbrennungsanlage bei der Zürcher Josefswiese zierte, entfernt worden, prangt schon ein neuer Schriftzug darauf: «100% Noigass». Auf Flyern zwar nur, aber mit einer klaren Botschaft versehen: «Wir lassen uns nicht wegputzen!»
«Noigass» ist der Name des Vereins, der verlangt, dass die Stadt Zürich das Neugass-Areal der SBB im Kreis 5 kauft oder – zusammen mit gemeinnützigen Bauträgern wie Wohnbaugenossenschaften – im Baurecht übernimmt. Ziel ist es, dass das 30 000 m2 grosse Areal, auf dem aktuell noch Lokomotiven und Waggons gewartet werden, gänzlich sozial nachhaltig überbaut wird. 375 Wohnungen können dort gemäss den Plänen der SBB entstehen, wenn die Stadt der Umzonung zustimmt.
Ein Drittel reicht nicht
Die SBB luden 2017 erstmals die Bevölkerung dazu ein, mitzuwirken – vorbildlich. Das Resultat vermochte die Quartierbevölkerung dann aber nicht zu begeistern: Das Unternehmen, das gänzlich dem Bund gehört, sah nur gerade ein Drittel bezahlbare Wohnungen vor. Quartierbewohner*innen und erfahrene Häuseraktivist*innen hatten dies kommen sehen und gründeten umgehend den Verein «Noigass», lancierten eine Petition und reichten gleich darauf erfolgreich die 100%-Initiative ein, die die Stadt zum Kauf des Areals auffordert – ungeachtet dessen, ob die SBB dieses überhaupt verkaufen wollen oder nicht. Der Stadtrat sträubte sich gegen den Vorstoss aus der Zivilbevölkerung und wollte die Initiative vom Gemeinderat für ungültig erklären lassen. Vergeblich.
Aber anstatt die Vorlage nun zeitnah zur Abstimmung zu bringen, zierte sich die Regierung weiter und versuchte abermals den Gemeinderat dazu zu bewegen, die Initiative für ungültig zu erklären. Dieser aber bekräftigte kürzlich seine Unterstützung – und genehmigte gleichzeitig auch den Vertrag, den die Stadt in der Zwischenzeit mit den SBB ausgehandelt hatte. Er enthält zusätzlich zum bereits geplanten Drittel gemeinnützige Wohnungen ein weiteres Drittel Wohnungen, die während fünfzig Jahren Kostenmieten haben werden. Die den SBB abgerungenen, vertraglich geregelten Zugeständnisse sind nun sozusagen die Rückversicherung, falls die Initiative scheitern sollte – und der Vertrag werde durch die Initiative auch nicht infrage gestellt, sagt Noigass-Vorstandsmitglied und Alt-Gemeinderat Niklaus Scherr.
Profit auf einst enteignetem Land
Im September können die stimmberechtigten Stadtzürcher*innen über die Initiative entscheiden. Die bürgerlichen Gegnerinnen loben den Kompromiss, den der Stadtrat mit den SBB ausgehandelt hat, und finden das Festhalten an der Initiative trotzig und lästig. Wer in einem nur spärlich ausgeleuchteten Eisenbahntunnel darauf schaut, mag das so sehen, denn ein Drittel unbefristet gemeinnützig klingt schon mal recht gut. Und ein weiteres Drittel auf fünfzig Jahre hinaus «preisgünstig» noch besser. Dazu ein Schulhaus und ein Anteil günstiger Gewerbeflächen!
Aber das ist eben nur ein Teil der Geschichte. Die ganze beinhaltet auch Enteignungen und immense Wertsteigerungen über viele Jahrzehnte. Sozial nicht nachhaltiges Profitdenken und damit einhergehend der Verdacht auf sogenanntes Bluewashing (das Vortäuschen sozialer Gerechtigkeit und Verantwortung). Und ganz grundsätzlich: Zielkonflikte zuungunsten der urbanen Bevölkerung im ganzen Land. Ausserdem besteht, ganz aktuell, sogar der Verdacht auf systematisches Unterlaufen des Mietrechts. Und das alles beim Unternehmen SBB, das zu hundert Prozent dem Bund gehört.
Der Reihe nach.
Mietertrag von über 600 Millionen Franken
Die SBB sind nach Mieteinnahmen gerechnet heute die zweitgrösste Immobilienbesitzerin im Land (hinter der Swiss Life). Mit ihren Liegenschaften erwirtschafteten sie 2021 laut Geschäftsbericht einen Mietertrag von 608,3 Millionen Franken. Der SBB-Immobilienbereich ist seit 2008 eine eigenständige Division innerhalb des Konzerns und hat Einsitz in der Konzernleitung. Wichtig zu verstehen ist: Die Strategie von SBB Immobilien ist vom Bundesrat vorgegeben – und in den letzten Jahren waren stets eine marktorientierte Bewirtschaftung, branchenübliche Renditen und Wertsteigerungen das Ziel. Denn SBB Immobilien muss jedes Jahr 150 Millionen Franken an die SBB-Infrastruktur bezahlen sowie zur Sanierung der Pensionskasse beitragen. Können die SBB auf ihren gleisnahen Böden Immobilien mit hoher Rendite erstellen, dient das dem Erreichen dieser Vorgaben.
Bis 2040 planen die SBB rund 12 000 weitere Wohnungen, die Hälfte davon im preisgünstigen Segment. Wobei «preisgünstig» nach eigener Definition heisst: «günstiger als die Hälfte der umliegenden Wohnungen». Was auch bedeutet: teurer als die andere Hälfte. Man orientiert sich dabei also per Definition ausschliesslich am Markt. Es besteht aber auch Grund zur Hoffnung, dass die SBB eine Weiche in Richtung mehr soziale Verantwortung stellen. Denn sie wollen laut Pressesprecher Daniele Pallecchi vermehrt Wohnungen im Baurecht abgeben, etwa an gemeinnützige Wohnbauträger, meist Genossenschaften.
SBB unterstützten Genossenschaften
Das Unternehmen SBB war eine sozial nachhaltige Wohnbauträgerin, noch bevor dieser Begriff erfunden war – und sie war es aus gutem Grund, denn ihre Angestellten waren darauf angewiesen, nahe den Betriebsgebäuden bezahlbar wohnen zu können, in der ganzen Schweiz. So unterstützten die SBB die Genossenschaften der Bahnarbeitenden, die vor rund hundert Jahren zu den Pionieren des genossenschaftlichen Wohnungsbaus gehörten. Heute lautet die Antwort des Pressesprechers auf die Frage, wo ein SBB-Rangierarbeiter, der in Zürich oder Basel wohnt, noch eine bezahlbare Wohnung finden soll: «Seit Jahrzehnten finden SBB-Mitarbeitende günstige Wohnungen bei Personal- und Eisenbahnergenossenschaften.» Für frühere Zeiten trifft das wohl zu – heute aber ist es für Leute, die keinen Lohn im oberen Segment haben, schwierig geworden, in bestehende Genossenschaftssiedlungen reinzukommen. Selbst wenn sie Familie haben. Es braucht darum mehr Genossenschafts- und andere Wohnungen zur Kostenmiete, gerade in den Städten, wo die meisten arbeiten.
Neue, günstige Wohnungen bauen ist aber in Zürich und anderen Städten enorm schwierig geworden, weil die Baulandreserven fehlen und weil gemeinnützige Wohnbauträger bei den aktuellen Boden- marktpreisen nicht mithalten können. Verdichtung heisst die Lösung. Aber worüber viel zu selten gesprochen wird: Die SBB haben auf städtischen Gebieten tatsächlich noch Reserven, die zu Bauland umgezont werden können. Sie kann also gegenüber den Städten Hand bieten, mit starker Hebelwirkung. Winwin. In der Stadt Zürich sei der Zug dafür eigentlich schon abgefahren, sagt Niklaus Scherr, der 2018 für eine umfassende Recherche die verschiedenen Areale der SBB genauer unter die Lupe genommen hat. Deshalb gebe man die Neugasse nicht einfach auf: «Sie ist quasi das letzte Areal der SBB auf Zürcher Boden, für das wir noch kämpfen können.» Es sei auch die vorerst letzte Chance der SBB, Hand zu bieten, damit die Stadt das dringend benötigte Drittelsziel gemeinnütziger Wohnungen erreichen kann. Scherr: «Nur wenn auf dem Neugasse-Areal zu 100 Prozent gemeinnützige Wohnungen gebaut werden, dürfen die SBB behaupten, ein Drittel der Neubauwohnungen auf SBB-Arealen in Zürich sei gemeinnützig. Heute sind bloss 313 oder gerade mal ein Fünftel der neu erstellten Wohnungen gemeinnützig.»
Das Land zurückgeben
Immerhin ein Fünftel, ist man jetzt vielleicht geneigt zu denken. Nur: In Zürich und andern Städten wurde das Land einst für die SBB enteignet, weil der Bau von Bahninfrastruktur ein dringliches Interesse der Allgemeinheit war – und Zürich profitierte in der Folge wirtschaftlich stark davon. In jüngeren Jahren nun erstellte die SBB auf Land, das sie an dieser zentralen Lage nicht mehr braucht, Shoppingcenter, Bürokomplexe und Luxuswohnungen. Damit verdient der bundesnahe Betrieb über die Jahre gerechnet Milliarden. Das Land, das ihr einst zugesprochen wurde, damit es einen wichtigen öffentlichen Zweck erfüllt, dient mittlerweile vor allem der Gewinnmaximierung. Auch das Land an der Neugasse wurde einst bundesverfassunsgetreu Privaten und der Stadt genommen und der SBB zugesprochen, um eine Infrastruktur zu ermöglichen, die hohem öffentlichem Interesse entsprach. Niklaus Scherr: «1925 musste die Stadt den SBB im Kreis 5 Land abtreten, damit diese darauf ein Bahndepot erstellen konnte. Dieses Land macht zwei Drittel des Areals aus, das jetzt überbaut werden soll.» Ist es nicht ganz einfach logisch, dass dieses Land der Stadt wieder zurückgegeben wird, wenn es seinen ursprünglichen gemeinnützigen Zweck nicht mehr erfüllt?
Manche finden, die SBB erfüllten mit ihren Immobilien ebenfalls einen gemeinnützigen Zweck, wenn sie damit die Bahninfrastruktur quersubventionieren. Das mag stimmen, und das können sie auch weiterhin tun – indem sie das Land, das sie nicht mehr für ihr Kerngeschäft benötigen, den Städten zu einem fairen Preis wieder zurückgeben. Und indem sie prioritär gemeinnützige Wohnbauprojekte ermöglichen – auch daran würden sie verdienen. Wie überhaupt mit Wohnungen und Räumen, die zu gesetzeskonformen Konditionen vermietet werden.
Unbehagen in Bundesbern
Stattdessen steht aktuell der Verdacht im Raum, dass die SBB bewusst zu hohe Mietrenditen abschöpfen. Dem «Blick» wurde ein SBB-internes Papier zugespielt, aus dem hervorgehen soll, dass die SBB grundsätzlich Marktmieten verlangen wollten. Die Hinweise nähren den Verdacht, dass das öffentlich-rechtliche Bahnunternehmen an bestimmten Orten gezielt überzogene Mieten verlangt, die angefochten werden könnten. Es würde dann – wie so viele andere auch – den Markt maximal ausreizen und hoffen, dass keine Mietenden den Anfangszins anfechten. Nationalrat Beat Flach (GLP) will deshalb mit einer Motion erwirken, dass bundesnahe Betriebe ihre Mietpreisberechnungen und Mietrenditen pro Mietobjekt künftig offenlegen müssen.
Und das ist nicht der einzige Vorstoss in Bundesbern, der zeigt, dass die Immobilienpolitik der SBB (respektive: des Bundesrates für die SBB) nun auch auf Bundesebene zunehmend für Unbehagen und Irritation sorgt. SP-Nationalrat Christian Dandrès, der auch im Vorstand des MV Schweiz ist, will erwirken, dass die SBB ihre Mietzinspolitik grundsätzlich sozial nachhaltig ausrichten. Er verlangt Kostenmieten und Mietzinskontrollen bei ihren Immobilien, damit Menschen und besonders auch Familien mit mittlerem oder bescheidenem Einkommen sowie das Kleingewerbe und Selbstständigerwerbende nicht vertrieben werden. Das ist ein Anliegen, das auch der Städteverband unterstützt, wie Projektleiter Dominic Blumenthal sagt: «Als grosse Immobilienbesitzerin und Arealentwicklerin tragen die SBB eine hohe Verantwortung gegenüber den Städten, einen Mehrwert für das Allgemeinwohl zu schaffen.»
«Noigass» kämpft für die ganze Schweiz
Mit Luxuswohnungen aber, die sich nicht einmal durchschnittliche 1.-Klasse-Zugreisende leisten können, schaden die SBB der Allgemeinheit wohl eher, als dass sie ihr nützen. Ohnehin gehören solche Wohnungen nicht in städtische Wohnquartiere und schon gar nicht, wenn der Boden via SBB dem Bund, also der öffentlichen Hand, gehört. Der Bund soll gemäss Bundesverfassung im Gegenteil dafür sorgen, dass bezahlbarer Wohnraum entsteht – heute gerade auch in den unter Druck stehenden Städten. Dafür kämpft der Verein Noigass im Zürcher Kreis 5 mit seiner 100%-Initiative. Man könnte auch sagen, die rund 400 Mitglieder zählende und weiter wachsende Gruppe kämpfe lokal für eine 100% gemeinnützige Neugasse und zugleich für 100% soziale Verantwortung der SBB Immobilien, in der ganzen Schweiz.
Dieses Ziel mag verwegen klingen, aber der Zeitpunkt stimmt: Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) und das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) sind daran, die Grundlagen für die ab 2023 geltenden strategischen Ziele der SBB zu erarbeiten. Auch könnte der Nationalrat jetzt dafür sorgen, dass der Auftrag, den SBB Immobilien hat, den heutigen Bedürfnissen angepasst wird: Der bundesnahe Betrieb soll die Städte darin unterstützen, den bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, den diese so dringend benötigen.
Nicht der erste Widerstand aus dem Kreis 5
Teilweise dieselben Leute aus dem Kreis 5, die hinter der 100%-Initiative stehen, sorgten schon vor rund zwanzig Jahren einmal mittels einer Abstimmung dafür, dass die SBB ihre Pläne ändern mussten. Anstelle eines viel breiteren Viadukts durchs Quartier bauten die SBB die Durchmesserlinie. Im Nachhinein gesehen eine Riesenchance für die Schweizerischen Bundesbahnen.
Text: Esther Banz