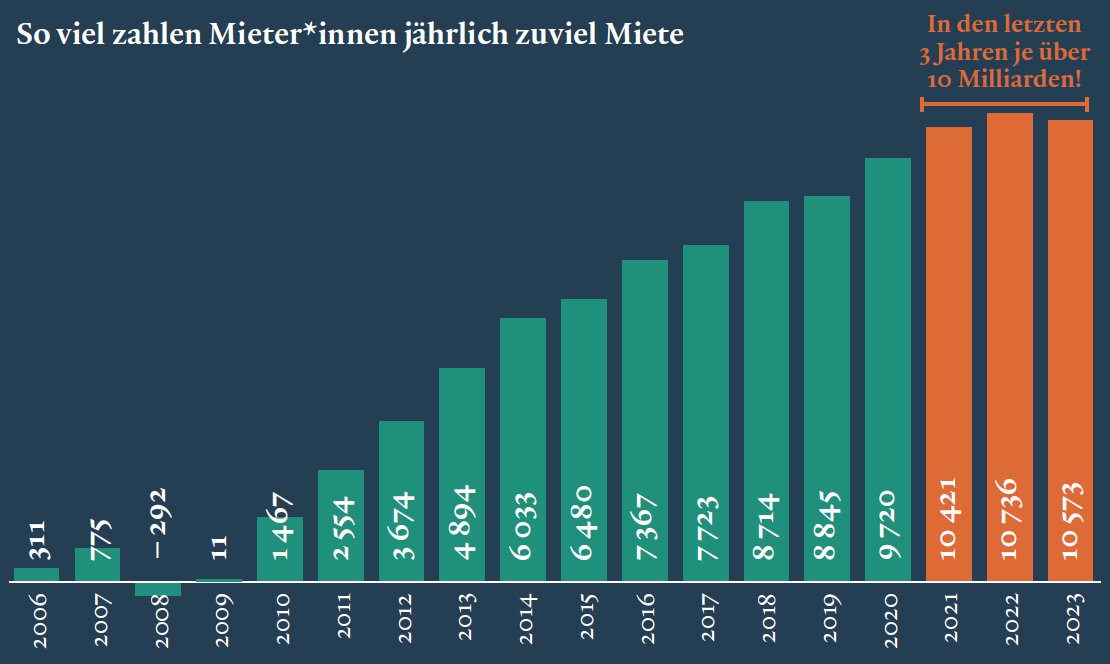Sanierungen bringen oft viel Unruhe mit sich, und nicht selten erhalten alle Mieter*innen eine Kündigung. Doch Widerstand kann sich lohnen – diese Tipps zeigen, wie vorzugehen ist.
Als Brigitte und Rolf Hugentobler eines Tages einen Brief von ihrer Hausverwaltung erhalten, staunen sie nicht schlecht: Ein Termin zur Begutachtung ihrer Wohnung wird angekündigt. Vor wenigen Tagen war bereits ein Handwerker dort, um die Leitungen zu inspizieren. «Will die Vermieterin sanieren? Bedeutet das eine baldige Kündigung?» fragen sie sich besorgt.
Ihre Befürchtung kommt nicht von ungefähr. Massenkündigungen wie die bei den «Sugus-Häusern» im Zürcher Kreis 5 verunsichern viele Mieter*innen. Ihr Wohnhaus wurde in den 80er-Jahren gebaut und seither nicht modernisiert. Zwar wirkt die Einrichtung mit ihren braunen Küchenfronten und den bunten Badezimmerfliesen altmodisch, doch für die Hugentoblers ist ihr Zuhause perfekt. Seit Jahrzehnten nennen sie diese Wohnung ihr Zuhause, haben hier ihre Kinder grossgezogen, Nachbarschaft gelebt und Wurzeln geschlagen. Eine Kündigung würde nicht nur den Verlust der Wohnung bedeuten, sondern auch den Abschied von der vertrauten Gemeinschaft. Zudem ist die Miete im Vergleich zu den allgemein gestiegenen Wohnkosten moderat – ein wesentlicher Faktor für viele Bewohner*innen der Liegenschaft.
Manche Renovationen sind möglich, ohne dass Mieter*innen ausziehen müssen. Doch oft wird behauptet, eine Sanierung mache den Verbleib unmöglich – sei es aus praktischen Gründen oder mit dem Hintergedanken, danach höhere Mieten verlangen zu können. Ob es wirklich so ist, sollte genau geprüft werden.
Vorübergehender Auszug als Lösung
Das Bundesgericht hat entschieden, dass eine Kündigung aufgrund einer Sanierung missbräuchlich sein kann, wenn Mieter*innen einen temporären Auszug anbieten. In diesem Fall stellt die Anwesenheit der Mieter*innen kein Hindernis für die Bauarbeiten dar, sodass ein schutzwürdiges Kündigungsinteresse fehlt. Die Hugentoblers sollten also noch vor einer allfälligen Kündigung schriftlich erklären, dass sie bereit wären, während der Sanierung vorübergehend auszuziehen – die sogenannte Auszugsgarantie –, um danach in ihre renovierte Wohnung zurückzukehren. Dieses für Mieter*innen wichtige Instrument wurde nun vom Obergericht des Kantons geschwächt. Das Mietgericht Zürich hatte sich kürzlich mit der Frage zu beschäftigen, wie es mit der Missbräuchlichkeit aussieht, wenn die Mieterschaft erst nach Erhalt der Kündigung eine Auszugsgarantie abgibt, und gab dem betroffenen Mieter recht. Die Gegenseite zog das Urteil weiter und errang ihrerseits einen Sieg vor dem Zürcher Obergericht. Dieses war der Meinung: Eine einmal gültig ausgesprochene Kündigung bleibt bestehen, selbst wenn die Mieterschaft später eine Auszugsgarantie gibt.
Fragwürdiges Urteil
Das Urteil des Obergerichts ignoriert den eigentlichen Zweck der Kündigung und ist deshalb fragwürdig. Wenn Mieter*innen garantieren, für die Sanierung auszuziehen, ist eine Kündigung überflüssig. Dennoch hielt das Gericht an der Gültigkeit der Kündigung fest – obwohl sie keinen praktischen Nutzen mehr hat.
Das benachteiligt kooperative Mieter*innen und verschafft Vermieter*innen mehr Spielraum, Kündigungen auch ohne echten Bedarf durchzusetzen. So können Mieter*innen ihre Wohnung verlieren, obwohl sie der Vermieterschaft gar nicht im Weg stehen. Was können Mieter*innen dennoch tun?
Gemeinsam auftreten
Mieter*innen haben bessere Chancen, wenn sie sich zusammenschliessen und gemeinsam Forderungen stellen. Dabei sollten ihre Anliegen strukturiert und geordnet werden. Die Hugentoblers könnten in ihrer Hausgemeinschaft eine Sprecherrolle übernehmen und die Gespräche mit der Vermieterin führen. Eine faire Vermieterin sollte in einem solchen Fall versuchen, die Sanierung sozialverträglich zu gestalten.
Öffentlichkeit als Hebel
Für Herrn und Frau Hugentobler kommt es anders: Als sie das Gespräch mit der Vermieterin suchen, blockt sie ab – von Entgegenkommen keine Spur. Nun könnten die Hugentoblers mediale Aufmerksamkeit suchen. Öffentlicher Druck könnte die Vermieterin zu Kompromissen bewegen. Auch die Unterstützung durch politische Entscheidungsträger*innen oder den Mieterinnen-und Mieterverbands kann hilfreich sein, insbesondere bei grossen Bauprojekten. 17
Kündigung: Form ist Pflicht
Da die Vermieterin die Wohnungen ohne Bewohner*innen sanieren will, kündigt sie allen Mietparteien, auch den Hugentoblers. Doch gesetzlich muss eine Kündigung bestimmten Formalitäten entsprechen: Sie muss auf einem amtlich genehmigten Formular erfolgen, sonst ist sie nichtig. Da die Hugentoblers verheiratet sind, muss die Vermieterin jedem Ehepartner ein separates Kündigungsformular zusenden, selbst wenn nur eine Person den Mietvertrag unterschrieben hat.
Timing zählt
Die Vermieterin muss sich an die vertraglichen Kündigungsfristen und -termine halten. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, an dem die Hugentoblers das Einschreiben entgegennehmen oder es erstmals hätten bei der Post abholen können. Ab diesem Zeitpunkt beginnt auch die Rechtsmittelfrist für eine Kündigungsanfechtung und/oder ein Erstreckungsbegehren zu laufen. Der Folgetag ist Tag eins der 30-tägigen Anfechtungsfrist. Das gilt unabhängig davon, ob die Hugentoblers die Sendung abholen oder nicht. Ein Ignorieren eingeschriebener Post ist deshalb keine gute Idee – die Frist bleibt die gleiche.
Kündigungen anfechten
Den Hugentoblers bleibt nur noch eine Option: die Kündigung innerhalb von 30 Tagen bei der Schlichtungsbehörde anfechten. Verpassen sie diese Frist, gilt die Kündigung als akzeptiert – selbst wenn sich die Sanierung später als «faule Ausrede» entpuppt. Laut Bundesgericht sind die Chancen einer Anfechtung gut, wenn die Sanierung auch im bewohnten Zustand ohne grössere Verzögerung oder Komplikationen machbar wäre. Dazu zählen beispielsweise Malerarbeiten, Balkonanbauten oder Fassadenrenovationen. Dann fehlt ein schutzwürdiger Kündigungsgrund. Eine Kündigung «auf Vorrat» ist ebenfalls missbräuchlich, etwa wenn noch kein Baugesuch eingereicht, nur ein Investitionsplan vorliegt oder die Finanzierung nicht gesichert ist. Eine Kündigung gilt auch dann als missbräuchlich, wenn die geplante Sanierung unrealistisch oder gar unmöglich erscheint – insbesondere wenn weder der Umfang der Arbeiten noch die Notwendigkeit des Auszugs der Mietenden klar beurteilt werden können.
Wird eine Kündigung als missbräuchlich eingestuft, wird sie aufgehoben und die Mieter*innen kommen zusätzlich in den Genuss einer Kündigungssperrfrist. Diese schützt Mieter*innen vor Kündigungen aus Vergeltung, etwa nach einer erfolgreichen Kündigungsanfechtung. Die Vermieterschaft darf dann für drei Jahre nicht kündigen, es sei denn, es liegt ein gesetzlich anerkannter Grund vor.
Erstreckung des Mietverhältnisses
Eine Kündigung bedeutet nicht automatisch, dass die Hugentoblers sofort ihre sieben Sachen packen und ausziehen müssen – selbst dann nicht, wenn die Schlichtungsbehörde oder das Gericht die Kündigung als rechtmässig einstuft. In vielen Fällen haben Mieter*innen die Möglichkeit, eine Mieterstreckung zu beantragen. Dann wird genau geprüft: Wie hart trifft sie der Verlust ihrer Wohnung? Und wie dringend ist das Sanierungsprojekt der Vermieterschaft tatsächlich?
Die Entscheidung über eine Erstreckung ist eine Ermessensfrage. Das heisst, es gibt keine festen Regeln, aber bestimmte Faktoren spielen eine Rolle. Wer finanziell nicht auf Rosen gebettet ist oder Kinder hat, kann oft mit einer längeren Erstreckung rechnen. Auch die Wohnungssituation am Markt ist entscheidend: Je schwieriger es ist, eine Ersatzwohnung zu finden, desto eher wird eine Erstreckung gewährt. Es lohnt sich, aktiv nach einer neuen Bleibe zu suchen und die Bemühungen mit Bewerbungsschreiben oder Internetanfragen zu dokumentieren.
Üblicherweise dürfen Mieter*innen noch einige Monate bleiben, in manchen Fällen sogar länger als ein Jahr. Die gesetzliche Höchstdauer für eine Erstreckung beträgt vier Jahre. Ein so langer Aufschub ist aber in der Praxis eher die Ausnahme – leider.
Fazit: Sanierung heisst nicht automatisch Vertreibung. Wer sich organisiert, seine Rechte kennt und aktiv handelt, kann eine Kündigung anfechten, eine Erstreckung erwirken oder durch öffentlichen Druck faire Lösungen erzwingen. Mieter*innen sind nicht machtlos – wer sich wehrt, kann gewinnen.
Text: Fabian Gloor