Leerstehende Feriendomizile zuhauf, aber die arbeitende Bevölkerung findet keine bezahlbaren Wohnungen: Im Engadin und anderswo spitzt sich die Lage zu. Einzelne Gemeinden halten dagegen, mit einigem Erfolg.
Ankommen im Oberengadin. Nach knapp zwei Stunden fährt der Zug der Rhätischen Bahn, der auf der Albulastrecke soeben rund tausend Höhenmeter überwunden hat, im Bahnhof Samedan ein. Der blaue Himmel, die nahen Bergflanken und die winterlichen Temperaturen versprechen frische, gesunde Luft. Stattdessen empfängt starker Kerosingeruch die Ankommenden. Es wird wohl gerade ein Privatjet gelandet oder gestartet sein auf dem nahen Flugplatz. Samedan liegt unweit von St. Moritz. Weitere beliebte Ferienorte wie Pontresina und Sils Maria befinden sich in nächster Nähe. Das Bündner Hochtal kennt man auf der ganzen Welt. Oder besser: Kennen die Reichen dieser Welt. Und nicht wenige von ihnen freuen sich über ein paar Tage Ferien im Jahr in dieser fantastischen Bergwelt – manche im Hotel, andere im eigenen Haus oder der privaten Ferienwohnung, ihrem Zweit- oder Drittzuhause. Es kommt also nicht von ungefähr, dass der bekannte Umweltschützer Franz Weber im Engadin in den 1960er-Jahren seinen ersten grossen Kampf führte. Mit Erfolg: Die Seenebene und Ufer sind geschützt und dürfen nicht verbaut werden.
Die Tricks in Bundesbern
Mehr als 40 Jahre später war Franz Weber wieder erfolgreich: Die Schweizer Stimmbevölkerung nahm 2012 die Zweitwohnungsinitiative an. Sie wollte den Anteil von Zweitwohnungen pro Gemeinde auf 20 Prozent begrenzen (wo diese nicht ohnehin schon überschritten sind). Aber in Bundesbern ist eine Mehrheit der Parlamentarier*innen mit der Bau-und Immobilienwirtschaft verbandelt. Das Gesetz zur Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative sollte die Landschaft vor Verbauung und die Menschen vor Verdrängung schützen – Ersteres funktioniert nur beschränkt und Letzteres gar nicht. Denn das Parlament beschloss, die sogenannt altrechtlichen Wohnungen und Häuser – jene, die vor 2012 schon standen – nicht vor der Umwandlung von Erst- in Zweitwohnungen zu schützen.
Um den bestmöglichen Preis geht es bei Immobilienverkäufen fast immer. Vielen Mieter*innen bleibt dann nur die Wahl zwischen Wegzug und überrissenen Mieten.
Das heisst, es können allmählich alle einstigen Erstwohnungen zu Zweitwohnungen werden. Verkäufe und Kündigungen sind schon jetzt die Folge davon, Mieter*innen werden aus ihren Häusern verdrängt. Und auf der grünen Wiese, am Rande der Dörfer, entstehen doch weiter neue Häuser – weil Einheimische nur noch dort wohnen können. Die problematische Entwicklung beschleunigt ausgerechnet ein Bündner: In Bundesbern erwirkte der Mitte-Politiker Martin Candinas eine weitere Lockerung des Zweitwohnungsgesetzes – jetzt ist es noch attraktiver, Häuser abzureissen und an ihrer Stelle Zweitwohnungen zu erstellen. Wegen dieser «Lex Candinas» wird sich die Lage für die Mieter*innen im Engadin und anderswo in touristischen Berggemeinden noch mehr zuspitzen, denn Zweitwohnsitze lassen sich sehr viel teurer verkaufen und vermieten als Erstwohnungen. Erstwohnungen werden von Menschen gesucht, die dort, wo sie leben, arbeiten – und die von ihrer Arbeit leben. In den touristischen Alpenregionen sind dies mehrheitlich Personen in Berufen mit niedrigen Löhnen: Gastgewerbe, Hotellerie und überhaupt Tourismus, Verkauf, Bau, auch Pflege. Wer sich hingegen an solchen Orten eine Zweit-Immobilie leisten kann, gehört zu den weit überdurchschnittlich Verdienenden, zu den Vermögenden.
Um den bestmöglichen Preis geht es bei Immobilienverkäufen fast immer. Vielen Mieter*innen bleibt dann nur die Wahl zwischen Wegzug und überrissenen Mieten. Das wirkt sich auch auf die Bevölkerungsstruktur in den Gemeinden aus: Wer arbeitet noch im Spital? Und wer sitzt am Schalter der Bergbahn und an der Kasse im Lebensmittelgeschäft?
Ausgehebelte Gemeindegesetze
In Sils hat die Schulleiterin an der Gemeindeversammlung darauf hingewiesen, dass die Zukunft der Schule ungewiss sei, weil die Kinder fehlen. Familien haben kaum noch eine Chance, eine bezahlbare Wohnung zu finden.
Dabei ist Sils eigentlich ein Vorzeigeort nicht nur wegen seiner Schönheit. Im Engadin war es eines der ersten Dörfer, die mit einem kommunalen Gesetz Erstwohnungen zu schützen versuchten, andere Gemeinden folgten dem Vorbild. Doch dann kam das in Bern gestaltete immobilienfreundliche Zweitwohnungsgesetz. Es hebelte die vorherigen, den Zweitwohnungsbau regulierenden Gemeindegesetze weitgehend aus. Man dachte, das nationale Gesetz und die daraus abgeleiteten neuen kommunalen Zweitwohnungsgesetze würden die alten Regeln ersetzen. Ein Irrtum mit weitreichenden Folgen, erst recht seit die Immobilienlobby auch die «Lex Candinas» durchgewunken hat, sogar gegen die eindringliche Empfehlung eines besorgten Bundesrats.
In Pontresina versuchte man es mit einer Spezialsteuer für «Zweitheimische» – mit den Einnahmen wollte man bezahlbaren neuen Wohnraum für Einheimische schaffen, für ein lebendiges Dorf auch in Zukunft. Aber der Widerstand war zu gross, die Vermögenden zu mächtig. Das Projekt scheiterte – wie zuvor ein vergleichbares in der Gemeinde Silvaplana.
In Sils brachte der Gemeinderat letztes Jahr mehrere Vorschläge zur Abstimmung. Der grösste Hebel wäre gewesen, altrechtliche Wohnungen nach Abriss und Neubau oder Totalsanierung mindestens zur Hälfte als Erstwohnungen zu erhalten – es hätten also nicht einfach ebenfalls lauter Zweitwohnungen daraus werden dürfen. Aber die Vorlage hatte keine Chance. Seither sei das Dorf gespalten, sagt Urs Kienberger, der viele Jahre das berühmte Hotel Waldhaus geführt hat. Dabei sei fast allen klar, dass gehandelt werden müsse. Aber die Situation sei vertrackt. «Die Menschen hier sind stolz darauf, dass Sils noch immer ein so schöner Ort ist. Sie möchten, dass das Dorf attraktiv bleibt, deshalb gibt es einen starken Konsens für Zurückhaltung beim Bauen. Aber das erhöht den Druck auf die altrechtlichen Wohnungen. Die müssten besser geschützt werden. Das Dorf soll ja weiterhin auch von Familien bewohnt bleiben.»
«Die Menschen hier sind stolz darauf, dass Sils ein so schöner Ort ist.»
Der Druck steigt und steigt
Zu den frühen regulierenden Massnahmen von Sils gehörte ein obligatorischer Erstwohnungsanteil bei Neubauprojekten, den erhöhte man 2010 sogar auf 50 Prozent. So konnten über hundert neue Wohnungen für die ansässige Bevölkerung geschaffen werden. Das Zweitwohnungsgesetz brachte aber auch das Silser Modell durcheinander, «und vor allem setzten sie in Bern die Initiative sehr fragwürdig in ein Gesetz um. Da hatten die Initiativgegner viel mehr die Federführung als die Befürworter», sagt Urs Kienberger. Jetzt müssen die Gemeinden strengere Gesetze erlassen, um ihre bestehenden Erstwohnungen zu schützen, aber, sagt der pensionierte Hotelier: «Verbote sind auf kommunaler Ebene viel schwieriger einzuführen und einzuhalten als auf nationaler.»
2018 – also noch vor Corona – dachte man in Sils noch, man könne das Gesetz sogar ein wenig zusätzlich lockern: Die bis dahin kommunal geschützten Erstwohnungen sollten nach 20 Jahren durch Bezahlen einer Ablösesumme in eine Zweitwohnung umgewandelt werden können. Doch dann verstärkte die Pandemie den Druck auf den Wohnraum in den schönen und gut erschlossenen Alpen zusätzlich. Der Gemeindevorstand schlug nun vor, die Lockerung wieder rückgängig zu machen. Aber dieser Vorschlag hatte im Juni 2024 an der Gemeindeversammlung keine Chance. Erst jetzt gelang es in einem zweiten Anlauf, den Schutz wieder einzuführen. Eine Einheimische hatte die Initiative ergriffen, Urs Kienberger und ein ehemaliger Gemeindepräsident zogen mit und gemeinsam erreichten sie eine Mehrheit. Es sei ein kleiner Schritt, sagt die Gemeindepräsidentin, Barbara Aeschbacher, zum Erfolg, aber immerhin: «Es ist gelungen, die neu geschaffenen Erstwohnungen wieder zu schützen. Der Druck ist gross, das rechtfertigt die Rückkehr zum bewährten Hebel.»
Pioniergemeinde Flims
Über den Silser Erfolg freut sich auch die Bündner Grossrätin Franziska Preisig (siehe Interview). Die Juristin lebt mit ihrer Familie in der Oberengadiner Gemeinde Samedan in einer Mietwohnung und weiss nie, wie lange noch. Sie engagiert sich auch im Mieterinnen-und Mieterverband Graubünden und kennt die Ausgangslage im Engadin bestens: Sie erzählt: «Flims hat den viel grösseren Coup gelandet.» Das bei Wintertourist*innen beliebte Flims liegt in der Surselva (dem Tal, aus dem auch der Mitte-Politiker Candinas stammt). Auch hier habe die Nachfrage nach Wohnraum in den vergangenen Jahren stark zugenommen, mit stark steigenden Immobilienpreisen als Konsequenz, wie die Gemeinde schreibt: «Dies erhöht den Druck auf die altrechtlichen Wohnungen stark, sodass diese vermehrt auf dem Zweitwohnungsmarkt gehandelt werden.» Und das wiederum führe zu unerwünschten Auswirkungen: Verdrängung der einheimischen Bevölkerung, fehlende Erstwohnungen für Neuzuzüger*innen, Entleerung des Dorfzentrums, Abwanderung. Und auch in Flims hätten Betriebe zunehmend Mühe, Personal zu finden, nicht zuletzt «aufgrund von fehlendem Wohnraum». Mindestens hundert Erstwohnungen wurden innerhalb von nur fünf Jahren in Zweitwohnungen umgewandelt, rechnete eine Studie der Fachhochschule Graubünden vor.
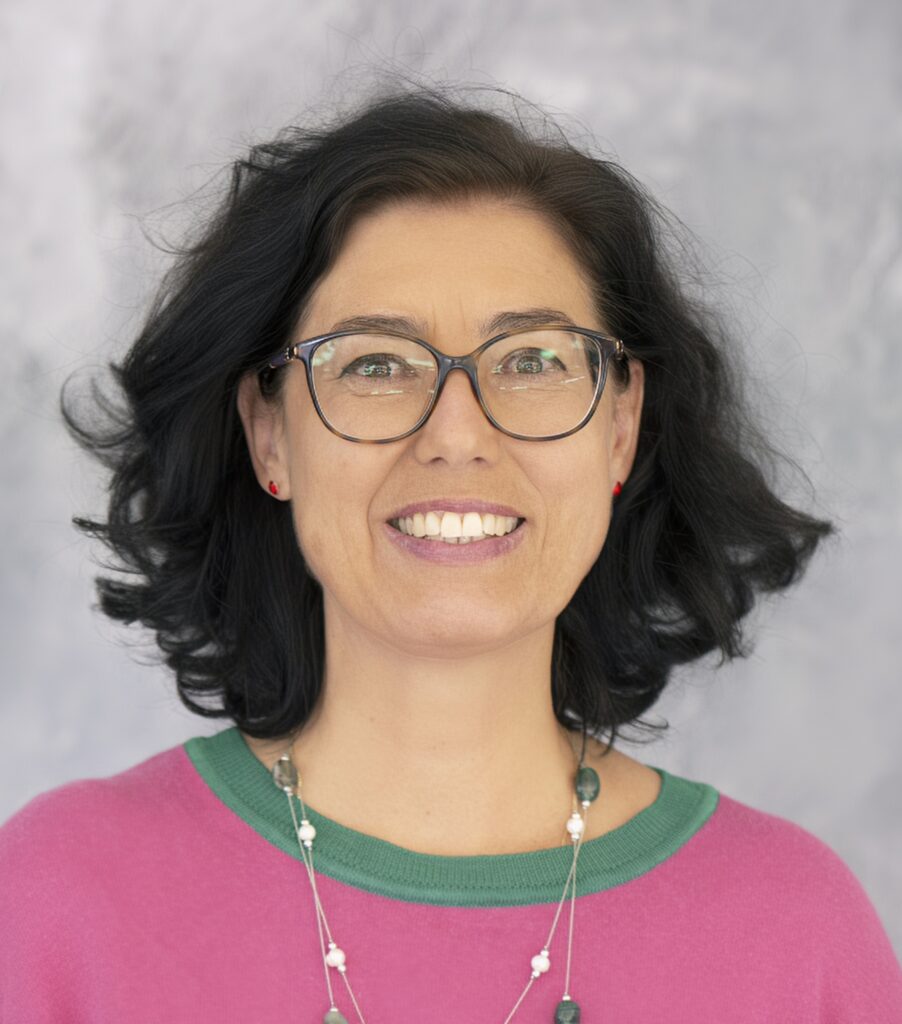
«Der Wohnraum ist falsch genutzt»
Im Engadin ist es kaum noch möglich, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Warum und mit welchen Folgen, erklärt die dort lebende Grossrätin Franziska Preisig. –> Zum Interview
Die Flimser Bevölkerung beschloss im 2023, mit einem obligatorischen Erstwohnungsanteil bei baulichen Massnahmen Gegensteuer zu geben.
Die Flimser Bevölkerung beschloss im November 2023 mit grosser Mehrheit, mit einem obligatorischen Erstwohnungsanteil bei baulichen Massnahmen Gegensteuer zu geben. So gilt jetzt das, was die Gemeindeversammlung in Sils ablehnte: eine Erstwohnungsverpflichtung von 50 Prozent bei Abbruch und Neubau und bei einem wesentlichen Umbau, der die Raumaufteilung verändert und weitere Wohnungen schafft. Alternativ muss eine Abgeltung entrichtet werden, wobei die Gemeinde mit diesen Beträgen einen Fonds zum Erstellen von Erstwohnungen äufnet.
Mit der Zweitwohnungsinitiative wollte man einst die Natur und die Dörfer vor allzu vielen kalten Betten schützen. Jetzt muss man sogar die warmen Betten schützen. Aber in den Gemeinden erkennt man zunehmend, wie problematisch die Bundespolitik für ihre Entwicklung ist. Und sie handeln.
